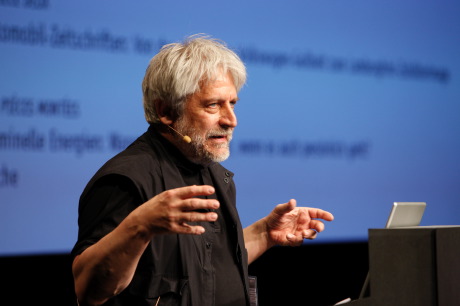Vier5 – follow me
Der Tisch ist mit Rosen in Wasserflaschen dekoriert und ein Hund sitzt auf einem der Rednerstühle, daneben die beiden Designer Marco Fiedler und Achim Reichert. Der Name Vier5 entstand aus der Hausnummer des ersten Studios. Die Beiden kennen sich seit dem Studium.

Fiedler und Reichardt mit eigener Tischdekoration
Fiedler zeigt sich erfreut über das vorgegebene Thema „Image“, normalerweise würden sie immer ihre Arbeit präsentieren. Jetzt nutzte Fiedler, der eigentlich den Vortrag alleine hielt, die Gelegenheit von seinem Bewusstsein als Designer zu berichten. Wichtig sei vor allem die eigene Positionierung. Das Image eines Designers entwickele sich insbesondere von außen und befinde sich in einem ständigen Prozess, so Fiedler. Vier5 wurde mit der Zeit bewusst, dass sie frei arbeiten, aber damit gleichzeitig Geld verdienen wollten.
Design ist für sie keine Dienstleistung im eigentlichen Sinne, sondern vorrangig eine künstlerische Arbeit. Der eigene Anspruch sei, dass man hinter den Projekten stehen kann und das die Arbeit Spaß mache. Man sei als Designer und Künstler öfters arbeitslos ohne es zu bemerken, man merke es nur daran ob man Geld oder kein Geld habe, zitiert Fidler einen seiner ehemaligen Professoren. Vier5 zogen nach Studiumsende nach Paris, zunächst ohne richtige Perspektive, doch nach kurzer Zeit tauchten plötzlich Kunden auf. Das Studio Vier5 in Paris besteht nach langen Jahren immer noch nur aus den beiden Gestaltern, zusammen mit einer Assistentin für Organisationsfragen und Fiedlers Hund. Sie wohnen auch noch in ihrer ersten Mini-Wohnung in Paris, von wo aus alles seinen Weg nahm. Beide wollen ihr Team nicht vergrößern, es geht ihnen um Qualität, nicht um Quantität in ihrer Arbeit.
Gestern fragte ihn eine Tischnachbarin, wo Vier5 den Vortrag halte. Fiedler sagte daraufhin scherzhaft, sie würden im kleinen Saal reden, im großen Saal wolle man sie nicht, er hätte sowieso das Gefühl, man wolle sie hier überhaupt nicht haben. Darauf sein Gegenüber, ja, es gäbe da ja Probleme, sie würden als unberechenbar gelten. Wer den Vortrag verpasst hat, darf traurig sein, Fiedler und Reichert gaben Einblicke in ihre eigenwillige, aber für sie zufriedenstellende Arbeitsweise als Designer. Sie lassen die Finger von dem, was sie nicht interessiert und fangen immer wieder, bei jedem neuen Projekt, von „vorne“ an. Ein Projekt muss eine Herausforderung sein. Weder der Kunde noch sie selbst wissen vorher, was dabei herauskommt.
Text und Foto: Linda Horn